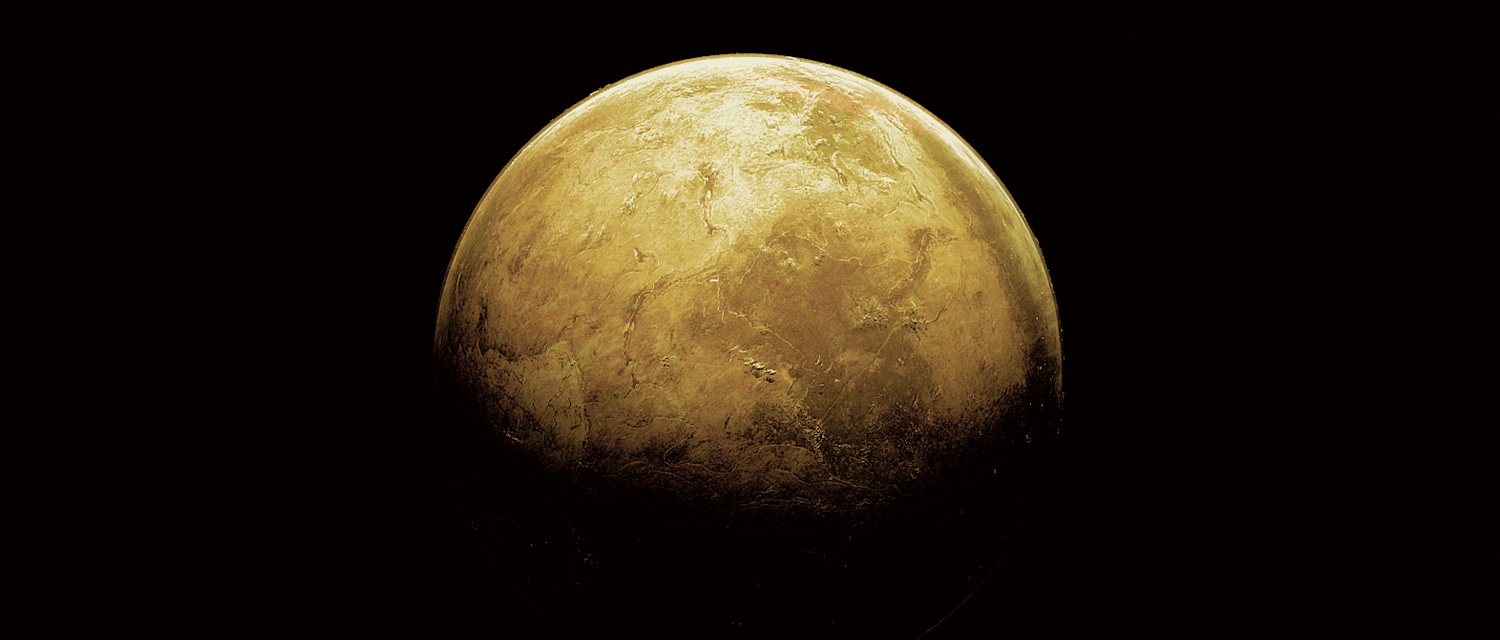
Mit seinem Weltbestseller Der Wüstenplanet (im Shop) hat Frank Herbert (1920–1986) uns Lesern die Türen zu einer faszinierenden Welt geöffnet. Auch wer nicht einen der Nachfolgebände oder die Romane aus dem erweiterten Universum von Frank Herberts Sohn Brian und SF-Autor Kevin J. Anderson (im Shop), gelesen hat, merkt bei der Lektüre des Wüstenplaneten, der jetzt in der neuen Übersetzung von Jakob Schmidt in unserem Shop erhältlich ist, dass er sich in einem Universum befindet, das vor allem eins ist: unglaublich alt. Viele Akteure im Wüstenplanet sind in Pläne verstrickt, die zum Teil bereits seit Jahrtausenden aktiv sind. Alles ist scheinbar mit allem verbunden. Wie soll man da den Überblick behalten?
Ein Hilfsmittel zur Orientierung ist der Universale Standardkalender im Wüstenplaneten. Das Jahr Null bezeichnet die Gründung der Raumfahrergilde, die das Monopol auf Weltraumflüge, -transporte und das Bankenwesen in der gesamten Galaxis hat und damit Ordnung in zuvor chaotische Systeme brachte. Damit unterteilen sich die Jahrtausende in „v. G.“ – vor der Gilde – und „n. G.“, nach der Gründung der Gilde. Gerechnet wird in Standardjahren, wobei man davon ausgehen kann, dass diese in etwa einem irdischen Jahr entsprechen, wenn auch rund zwanzig Stunden kürzer sind (vgl. Die Ketzer des Wüstenplaneten– im Shop). Im „Anhang II“ zu Der Wüstenplanet gibt uns Frank Herbert einige Hinweise, durch die wir Rückschlüsse auf das Verhältnis zwischen dem Universalen Standardkalender und unserer irdischen Zeitrechnung ziehen können:
Die Bewegung der Menschheit in den Tiefen des Alls drückte den Religionen im Laufe der einhundertundzehn Jahrhunderte vor Butlers Dschihad ihren unverwechselbaren Stempel auf.
Butlers Dschihad, der Krieg der Menschen gegen die Maschinen, war von 201 v. G. bis 108 v. G.; zuvor breitete die Menschheit sich rund 11 000 Jahre über das All aus. Die Handlung in Der Wüstenplanet beginnt im Jahr 10 191 n. G. Zählt man das zusammen und fügt noch rund die 2000 Jahre hinzu, die die Menschheit seit dem Jahr Null nach Christus gebraucht hat, um ins All vorzustoßen, erhält man das Jahr 23 392 nach Christus als Beginn der Handlung in Der Wüstenplanet. Diese Zahlen sind jedoch ungenau – wir wissen nicht, wann die Menschheit in Herberts Universum ins All aufgebrochen ist. Durch das etwas kürzere Standardjahr ergibt sich zudem eine Unschärfe von rund 400 Jahren. Im Großen und Ganzen bewegen wir uns in Der Wüstenplanet um das Jahr 23 400 nach Christus.
Natürlich kann eine dermaßen lange Vergangenheit nicht vollumfänglich in dieser Chronologie wiedergegeben werden. Erschwerend kommt hinzu, dass Frank Herbert sich nicht genau an seine eigene Chronologie hielt, als er die Nachfolgeromane zu Der Wüstenplanet (im Shop) schrieb. Einige Zahlen in dieser Timeline sind also mit Vorsicht zu genießen:
In grauer Vorzeit werden die „Sandforellen“, die später als „kleine Bringer“ bezeichnet werden, nach Arrakis gebracht. Sie beginnen mit der Austrocknung des damals noch wasserreichen Planeten und der Produktion des Gewürzes.
14500-14200 v. G.
Das Goldene Zeitalter der Erfindungen. Funk und Fernsehen, Raketen- und Nuklearwissenschaften, Genetik und Computertechnik werden entwickelt.
ab ca. 14100 v. G.
Die Menschen kolonisieren das Sonnensystem und breiten sich weiter im All aus. Das alte Imperium entsteht. Arrakis, jetzt schon ein Wüstenplanet, ist eine der letzten Welten, die noch vom alten Imperium erschlossen werden.
Unter der Herrschaft von Imperator Shakkad entdeckt der Chemiker Yanshuph Ashkoko das Gewürz auf Arrakis. Wissenschaftler besuchen den Wüstenplaneten, um einzuschätzen, ob sich der Planet für eine Kolonisierung eignet. Sie verlassen Arrakis im Jahr 1287 v. G.
5360 v. G.
Die ersten denkenden Maschinen werden entwickelt, um den Menschen alltägliche Aufgaben abzunehmen.
7585 v. G.
Erfindung des Ornithopters.
1182 v. G.
Die KI Omnius übernimmt die Herrschaft auf mehreren Planeten und richtet die synchronisierten Welten ein. Die Liga der Edlen, ein Zusammenschluss freier Welten, stellt sich Omnius entgegen. Sie verbietet den Gebrauch von KIs und schränkt die Benutzung von Computern ein.
400 v. G.
Die Zauberinnen vom Planeten Rossak beginnen zusammen mit der Ärztin Raquella Berto-Anirul, Stammbäume zu sammeln und auszuwerten.
203 v. G.
Der Physiker Tio Holtzmann entwickelt Störfelder, die die KIs nicht durchdringen können. Auf Arrakis entdeckt Selim, ein ausgestoßenes Waisenkind, das gelernt hat, in der Wüste zu überleben, wie man Sandwürmer reitet. Omnius erobert Giedi Primus, kann es jedoch nicht lange halten.
202 v. G.
Der Tleilax-Sklavenhändler Tuk Keedair entdeckt das Gewürz auf Arrakis. Tio Holtzmann konstruiert den Schutzschild, der auch noch Jahrtausende später zum Einsatz kommen wird. Diese Körperschilde sind transparente Energiefelder, die Materie, die sie durchdringen will, ab einer gewissen Geschwindigkeit zurückwirft. Zu Beginn explodieren sie, wenn sie von einem Laserstrahl getroffen werden, und vernichten Träger wie Angreifer. 195 v. G. entwickelt Holtzmann deswegen die sogenannte Lasgun-Schild-Interaktion. Es liegt unter anderem an diesen Schilden, dass selbst in ferner Zukunft noch Mann gegen Mann gekämpft wird.
201-108 v. G.:Butlers Dschihad
Butlers Dschihad ist das zentrale Ereignis in der Vergangenheit des Wüstenplanet-Universums: der Kampf der freien Menschen gegen die denkenden Maschinen, die von der KI Omnius und dem unabhängigen Roboter Erasmus angeführt werden. Omnius ist keine Entität, sondern besteht aus mehreren Rechenzentren auf verschiedenen Planeten. Er kontrolliert alle Maschinen außer Erasmus, der es geschafft hat, sich von ihm zu lösen.
201 v. G.
Erasmus tötet Manion, den kleinen Sohn der Sklavin Serena Butler, auf der Erde. Serena und der charismatische Sklaven-Vorarbeiter Iblis Ginjo beginnen einen Sklavenaufstand, der zum „heiligen Krieg“ wird. Als Omnius auf der Erde zurückschlägt, rettet Vorian Atreides Serena Butler und Iblis Ginjo und bringt sie nach Salusa Secundus. Die Liga der Edlen tritt in den Dschihad ein.
Auf Arrakis beginnen die beiden Tleilax-Sklavenhändler Tuk Keedair und Aurelius Venport damit, das Gewürz auf den Liga-Planeten zu verbreiten.
200 v. G.
Die Erde wird mit Atomwaffen beschossen, um Omnius dort zu vernichten, und die Heimatwelt der Menschen über Jahrhunderte hinaus unbewohnbar.
199-175 v. G.
Jahrzehntelang gelingt es weder der einen noch der anderen Seite, sich einen entscheidenden Vorteil im Dschihad zu verschaffen.
176 v. G.
Der Roboter Erasmus nimmt sich im Zuge einer Wette mit Omnius des Menschensklaven Gilbertus Albans an und bringt ihm die Maschinenlogik bei.
175 v. G.
Um sein über verschiedene Planeten verteiltes Bewusstsein immer wieder zu synchronisieren, setzt Omnius Datenschiffen ein. Vorian Atreides gelingt es, eines dieser Updateschiffe mit einem Virus zu infizieren und etliche von Omnius‘ Inkarnationen zu zerstören. Omnius führt daraufhin keine Updates mehr aus. Die Haupt-KI hat sich auf den Planeten Corrin zurückgezogen.
174 v. G.
Norma Cenva, Venports Frau, ist eine geniale Mathematikerin und arbeitet als Assistentin von Tio Holtzmann. Sie entwickelt die theoretischen Grundlagen für die Raumfaltschiffe. Norma baut das erste Raumfaltschiff auf dem Planeten Poritrin, doch es wird ihr von aufständischen Sklaven gestohlen, die damit nach Arrakis fliehen. Sie werden von den Siedlern, die bereits auf dem Wüstenplaneten leben, aufgenommen.
164 v. G.
Serena Butler reist nach Corrin, angeblich, um einen Frieden mit den Maschinen auszuhandeln. Doch sie provoziert Omnius, damit dieser sie tötet und sie so zur Märtyrerin macht. Als Omnius nicht darauf eingeht, bringt Iblis Ginjo Serena um, lässt es aber aussehen, als wäre Omnius der Schuldige. Der Dschihad geht weiter.
Die Dschihadisten bedienen sich der Hilfe der Tleilax, hervorragenden Genetikern. Sie schlachten Sklaven wie Bürger wegen ihrer Organe aus. Xavier Harkonnen deckt diesen Skandal auf, in den auch Iblis Ginjo verwickelt ist. Es gelingt ihm, seinem Verbündeten Vorian Atreides eine Nachricht zukommen zu lassen, ehe er Ginjo und sich selbst tötet. Doch die Wahrheit kommt nie ans Licht, weswegen die Harkonnen als Verräter in die Geschichte eingehen. Zwischen ihnen und dem Haus Atreides kommt es später zu einer Generationen währenden Feindschaft.
108 v. G.
Bei der Schlacht von Corrin benutzt Omnius menschliche Sklaven als Schutzschilde gegen die Dschihad-Flotte. Die Sklaven stecken in Containern, die explodieren, wenn die Raumschiffe eine bestimmte Grenze überschreiten. Erasmus schaltet die Sprengfallen jedoch aus, als sich Gilbertus Albans freiwillig an Bord eines Containers begibt. Albans überlebt und wird so zum allerersten Mentaten – den menschlichen Computern. Noch während der letzten Schlacht auf Corrin beschließt Omnius, als Datenstrom in die Tiefen des Alls zu flüchten. Nach dem Sieg erklärt sich Faykan Butler zum Imperator und nimmt den Namen Corrino an. Nach dem Ende des Dschihads wird aus der Liga der Edlen der Landsraad, der Zusammenschluss der Hohen Häuser.
88 v. G.
Auf Arrakis setzen Sklavenhändler den Siedlern immer mehr zu. Unter der Führung des ehemaligen Sklaven Ishmael ziehen sie sich in die Tiefen der Wüste zurück und werden zu den „free men“, den Fremen. Sie passen sich nach und nach perfekt an das harte Leben in der Wüste an.
Die Zauberinnen von Rossak benennen sich in Bene Gesserit um und starten das Programm, das später den Kwisatz Haderach hervorbringen soll.
87-1 v. G.
Die radikalsten Anhänger von Serena Butler zerstören weiterhin Maschinen. In ihrer Raserei vernichten sie aber auch historische Dokumente. Technisch orientierte Zivilisationen überleben nur auf den Planeten Ix und Richese. Gilbertus Albans gründet die Schule der Mentaten.
84 v. G.
Norma Cenva baut weitere Raumfaltschiffe. Sie entdeckt den Nutzen des Gewürzes für die Raumfahrt und wird nach der Einnahme einer Überdosis zur ersten Navigatorin – und damit zur Gründerin der Raumgilde.
1 v. G.
Gründung der MAFEA (Merkantile Allianz für Fortschritt und Entwicklung im All). Sie führt den Gildenkalender ein und monopolisiert den interstellaren Handel, das Transport- und das Bankenwesen. Dadurch unterwerfen sie nicht nur das Reisen, sondern auch die Kriegsführung ihren Regeln. Arrakis wird zum wichtigsten Planeten im Universum, weil nur hier das Gewürz gefunden wird. Eine Zeit relativer Ruhe und Stabilität tritt ein.
10018 n. G.
Imperator Elrood Corrino IX besteigt den Thron.
um 10070 n. G.
Eine Gruppe Bene-Gesserit-Schwestern auf Arrakis verschwindet, unter ihnen auch die Ehrwürdige Mutter Ramallo.
10114 n. G.
Das Haus Richese verliert das Recht, Arrakis zu verwalten. Dmitri Harkonnen wird Gouverneur.
10118 n. G.
Hasimir Fenring, den viele für das Endprodukt des Kwisatz-Haderach-Projektes halten, wird geboren.
10119 n. G.
Geburt von Elroods Sohn Shaddam, dem späteren Imperator.
10132 n. G.
Geburt von Glossu Rabban, dem ersten Sohn von Abulurd Harkonnen.
10135 n. G.
Geburt von Gurney Halleck.
10140 n. G.
Geburt von Herzog Leto Atreides.
10146 n. G.
Geburt von Duncan Idaho. Dmitri Harkonnen stirbt. Sein Sohn Abulurd wird auf eigenen Wunsch zum Gouverneur von Arrakis ernannt.
10153 n. G.
Baron Wladimir Harkonnen ersetzt seinen Halbbruder Abulurd als Gouverneur von Arrakis. Glossu Rabban tötet Duncan Idahos Eltern. Imperator Elrood ernennt Pardot Kynes zum Planetologen von Arrakis, wird aber im selben Jahr von Shaddam Corrino und Hasimir Fenring mit einem langsam wirkenden Gift vergiftet. Kynes arbeitet mit den Fremen zusammen und erforscht die Ökologie von Arrakis. Er entdeckt, dass die Welt einst wasserreich war und dass die Sandwürmer für die Austrocknung verantwortlich sind. Er zeigt den Fremen, wie sie Arrakis terraformen und wieder zu einer fruchtbaren Welt machen können.
10154 n. G.
Die Bene Tleilax starten auf Ix mit der Genehmigung des Imperators das Geheimprojekt Amal, um das Gewürz synthetisch herzustellen.
Unter Anleitung von Pardot Kynes beginnen die Fremen heimlich damit, Arrakis zu terraformen. Kynes ist von den Wüstenbewohnern so fasziniert, dass er einer von ihnen wird. Sein Sohn, Liet-Kynes, wird geboren.
Duncan Idaho tritt in die Dienste des Hauses Atreides ein. Paulus Atreides stirbt, die Herrschaft geht an seinen Sohn Leto über.
Jessica, die Tochter von Gaius Helen Mohiam und Wladimir Harkonnen, wird geboren.
10156 n. G.
Elrood IX. stirbt, und Shaddam Corrino IV wird Imperator. Er beordert Hasimir Fenring nach Arrakis.
10162 n. G.
Geburt von Prinzessin Irulan.
10166 n. G.
Duncan Idaho beginnt mit dem Schwertmeister-Training.
10168 n. G.
Jessicas Bene-Gesserit-Training auf Wallach IX ist abgeschlossen.
10170 n. G.
Gurney Halleck wird von den Harkonnen versklavt.
10171 n. G.
Leto Atreides macht sich im Landsraad einen Namen. Die Bene Gesserit schicken ihm Jessica, damit sie mit ihm ein Mädchen bekommt. Dieses Mädchen wiederum soll den Kwisatz Haderach zur Welt bringen.
10173 n. G.
Glossu Rabban tötet Gurney Hallecks Eltern. Halleck entkommt der Sklaverei. Gaius Helen Mohiam flößt Abulurd Harkonnen heimlich ein Potenzmittel ein, damit er ein männliches Kind zeugt. Dieses soll der Vater des Kwisatz Haderach werden.
10174 n. G.
Mohiams Plan geht auf, und Abulurd Harkonnens zweiter Sohn, Feyd-Rautha, wird geboren. Doch Abulurd legt den Namen Harkonnen ab, damit Feyd-Rautha nicht dessen Makel erbt. Aus Rache entführt Vladimir Harkonnen Feyd-Rautha und lässt Abulurd von Glossu Rabban töten.
Duncan Idaho schließt seine Ausbildung zum Schwertmeister ab.
Gurney Halleck schließt sich dem Haus Atreides an.
Pardot Kynes stirbt, und sein Sohn Liet-Kynes setzt sein Werk fort. Liet-Kynes Tochter Chani wird geboren.
10175 n. G.
Die Bene Tleilax stellen die bisher vielversprechendste Mischung des synthetischen Gewürzes her, das sie Ajidamal nennen. Shaddam IV beginnt den Großen Gewürzkrieg, bei dem er die Gewürzlager vernichten und Arrakis zerstören will. Doch das Ajidamal versagt, und der Krieg des Imperators ist verloren.
Paul Atreides wird geboren.
 10176-10192 n. G.
10176-10192 n. G.
Leto Atreides beginnt, eine kleine, aber hocheffiziente Kampftruppe ausbilden zu lassen. Der Imperator fühlt sich bedroht. Er schickt das Haus Atreides von Caladan nach Arrakis, wo es von den Harkonnen angegriffen wird. Diese werden von den Sardaukar des Imperators unterstützt. Leto stirbt, sein Sohn Paul und Jessica fliehen in die Wüste. Sie treffen auf die Fremen und werden von ihnen gerettet. Stilgar, einer ihrer Anführer, bringt sie in den Sietch Tabr. Dort wird Alia Atreides geboren. Paul Atreides wird zu Muad’Dib und zum Anführer der Fremen. Er lernt Chani kennen und verliebt sich in sie.
10193 n. G.
In der Schlacht von Arrakeen siegt Paul Atreides, unterstützt von den Fremen-Kriegern. Das Haus Harkonnen wird vernichtet, Paul Atreides übernimmt das Monopol über das Gewürz und heiratet Shaddams Tochter Irulan. Shaddam IV wird nach Salusa Secundus ins Exil geschickt. Paul Muad’Dib schickt seine Fremenkrieger, die Fedaykin, aus, um in einem Dschihad seine Vision von der Zukunft der Menschheit durchzusetzen. Pauls Dschihad beginnt.
10194 n. G.
Paul und Jessica reisen nach Caladan, wo Jessica zur Baronin wird.
10202 n. G.
Shaddam Corrino IV stirbt.
10206 n. G.
Pauls Dschihad endet.
10209 n. G.
Chani stirbt bei der Geburt der Zwillinge Leto Atreides II und Ghanima Atreides. Paul Muad’Dib erblindet, zieht sich in die Wüste zurück und verschwindet. Pauls Schwester Alia übernimmt die Regentschaft auf Arrakis, bis die Zwillinge erwachsen sind.
10210 n. G.
Alia löst die Fedaykin, die Fremen-Elitetruppen von Paul Atreides, auf. Die Fremen versinken nach und nach in der Bedeutungslosigkeit.
10219 n. G.
Alia Atreides stirbt. Leto Atreides II wird Gottkaiser und regiert 3 500 Jahre lang. Er bringt alle Welten mit eiserner Hand dazu, dem Goldenen Pfad, jener Zukunftsvision von Paul Muad’Dib, zu folgen. Doch das verlangt ein großes Opfer: Leto II. verschmilzt seinen Körper mit dem einer Sandforelle und wird so zu einem Hybrid aus Mensch und Sandwurm.
10256 n. G.
Jessica Atreides stirbt.
13728 n. G.
Leto II. stirbt. Siona Atreides und ein Klon Duncan Idahos erhalten Arrakis zum Lehen. Die Zeit der Diaspora beginnt.
um 15200 n. G.
Ende der Diaspora und Rettung der Menschheit.
Eine ausführliche Chronologie des Dune-Universums finden Sie unter anderem hier (in englischer Sprache).
Frank Herberts Roman Der Wüstenplanet, neu übersetzt von Jakob Schmidt, finden Sie in unserem Shop. Mehr Infos rund um das Dune-Universum finden Sie hier unter dem #WüstenplanetMonat.
Die Chronologie der Wüstenplanet-Romane:
• Butlers Djihad (Der Wüstenplanet - Die Legende 1, 2002)
• Der Kreuzzug (Der Wüstenplanet - Die Legende 2, 2003)
• Die Schlacht von Corrin (Der Wüstenplanet - Die Legende 3, 2004)
• Der Thron des Wüstenplaneten (2012)
• Das Haus Atreides (Der Wüstenplanet - Die frühen Chroniken 1, 1999)
• Das Haus Harkonnen (Der Wüstenplanet - Die frühen Chroniken 2, 2000)
• Das Haus Corrino (Der Wüstenplanet - Die frühen Chroniken 3, 2001)
• Der Wüstenplanet (1965)
• Paul Atreides (Der Wüstenplanet - Heroes of Dune 1, 2008)
• Stürme des Wüstenplaneten (Der Wüstenplanet - Heroes of Dune 2, 2009)
• Der Herr des Wüstenplaneten (1969)
• Die Kinder des Wüstenplaneten (1976)
• Der Gottkaiser des Wüstenplaneten (1981)
• Die Ketzer des Wüstenplaneten (1984)
• Die Ordensburg des Wüstenplaneten (1985)
• Die Jäger des Wüstenplaneten (2006)
• Die Erlöser des Wüstenplaneten (2007)




























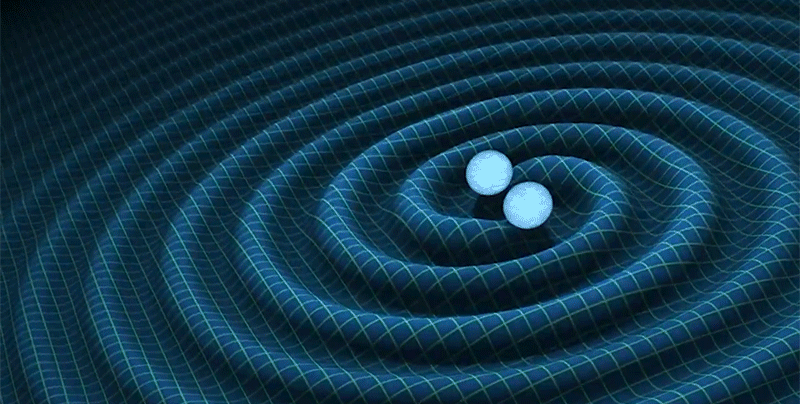



















 Dann schaltet es die Raketen ab und legt die letzten beiden Meter zur Oberfläche im freien Fall zurück. Die Aufprallgeschwindigkeit wird nur wenige Meter in der Sekunde betragen. Die Wucht des Aufschlags wird von einer speziell entwickelten Materialschicht abgefangen, die ähnlich wie eine Knautschzone im Auto wirkt. Sie soll verhindern, dass das Innenleben des Landemoduls beschädigt wird. Dieser ganze Vorgang wird weniger als sechs Minuten lang dauern, und während der ganzen Zeit wird Mars Express, der bereits seit 2003 um den roten Planeten kreist, sozusagen ein Auge auf Schiaparelli haben. Schiaparellis Landezone liegt im Meridiani Planum, einer Tiefebene auf Äquatorhöhe, durch die der marsianische Nullmeridian verläuft. Weil die Ebene so tief liegt, ist die Atmosphäre dort dicht genug, dass das Abbremsen mit einem Hitzeschild überhaupt funktionieren kann. Schiaparelli wird, wenn alles gut geht, der Raumsonde Opportunity Gesellschaft leisten, die seit 2004 die Gegend um den Eagle Krater erforscht.
Dann schaltet es die Raketen ab und legt die letzten beiden Meter zur Oberfläche im freien Fall zurück. Die Aufprallgeschwindigkeit wird nur wenige Meter in der Sekunde betragen. Die Wucht des Aufschlags wird von einer speziell entwickelten Materialschicht abgefangen, die ähnlich wie eine Knautschzone im Auto wirkt. Sie soll verhindern, dass das Innenleben des Landemoduls beschädigt wird. Dieser ganze Vorgang wird weniger als sechs Minuten lang dauern, und während der ganzen Zeit wird Mars Express, der bereits seit 2003 um den roten Planeten kreist, sozusagen ein Auge auf Schiaparelli haben. Schiaparellis Landezone liegt im Meridiani Planum, einer Tiefebene auf Äquatorhöhe, durch die der marsianische Nullmeridian verläuft. Weil die Ebene so tief liegt, ist die Atmosphäre dort dicht genug, dass das Abbremsen mit einem Hitzeschild überhaupt funktionieren kann. Schiaparelli wird, wenn alles gut geht, der Raumsonde Opportunity Gesellschaft leisten, die seit 2004 die Gegend um den Eagle Krater erforscht. ExoMars 2016 bereitet außerdem die zweite Mission, ExoMars 2018, vor, bei der ein Rover auf der Marsoberfläche abgesetzt werden soll. Der Rover ist mit einem Bohrer ausgerüstet, der bis in zwei Meter Tiefe Bodenproben entnehmen kann, die dann im bordeigenen Labor untersucht werden. Unterirdische Gesteinsproben enthalten möglicherweise sogenannte Biomarker, Hinweise auf Leben, das direkt auf der Oberfläche aufgrund der hohen Strahlung nach allem, was wir wissen, nicht gedeihen kann. Außerdem wird ein russisches Mini-Labor auf dem Mars abgesetzt. Für diese beiden Missionen soll der TGO als Funkrelais dienen.
ExoMars 2016 bereitet außerdem die zweite Mission, ExoMars 2018, vor, bei der ein Rover auf der Marsoberfläche abgesetzt werden soll. Der Rover ist mit einem Bohrer ausgerüstet, der bis in zwei Meter Tiefe Bodenproben entnehmen kann, die dann im bordeigenen Labor untersucht werden. Unterirdische Gesteinsproben enthalten möglicherweise sogenannte Biomarker, Hinweise auf Leben, das direkt auf der Oberfläche aufgrund der hohen Strahlung nach allem, was wir wissen, nicht gedeihen kann. Außerdem wird ein russisches Mini-Labor auf dem Mars abgesetzt. Für diese beiden Missionen soll der TGO als Funkrelais dienen.











 Sowohl „Das hündische Herz“ als auch die „Die verfluchten Eier“ handeln von Wissenschaftlern, die ihren Forscherdrang bis zum Äußersten treiben, ohne dabei auf moralische, religiöse oder politische Grenzen Rücksicht nehmen zu wollen. In „Das hündische Herz“ widmet sich der Chirurg und Professor Filipp Filippowitsch Preobraschenski der Verjüngerung des Menschen durch medizinische Eingriffe. Er transplantiert in seine Patienten tierische Organe, um den altersschwachen und wohlhabenden Menschen ein Stück ihrer Jugend zurück zu geben. Sein neuestes Forschungsobjekt ist jedoch ein Straßenköter, den er eines Abends mit einer Wurst ködert und in seine Praxis lockt. Lumpi, so der Name des Tiers, wird zunächst aufgepäppelt, bevor sich der Professor und sein Assistent daran machen, ihm die Hirnanhangdrüse und Hoden eines verblichenen Verbrechers einzupflanzen. Lumpi mutiert innerhalb kurzer Zeit zum Menschen, nennt sich Polygraph Polygraphowitsch Lumpikow und macht das Leben des Professors zur Hölle auf Erden.
Sowohl „Das hündische Herz“ als auch die „Die verfluchten Eier“ handeln von Wissenschaftlern, die ihren Forscherdrang bis zum Äußersten treiben, ohne dabei auf moralische, religiöse oder politische Grenzen Rücksicht nehmen zu wollen. In „Das hündische Herz“ widmet sich der Chirurg und Professor Filipp Filippowitsch Preobraschenski der Verjüngerung des Menschen durch medizinische Eingriffe. Er transplantiert in seine Patienten tierische Organe, um den altersschwachen und wohlhabenden Menschen ein Stück ihrer Jugend zurück zu geben. Sein neuestes Forschungsobjekt ist jedoch ein Straßenköter, den er eines Abends mit einer Wurst ködert und in seine Praxis lockt. Lumpi, so der Name des Tiers, wird zunächst aufgepäppelt, bevor sich der Professor und sein Assistent daran machen, ihm die Hirnanhangdrüse und Hoden eines verblichenen Verbrechers einzupflanzen. Lumpi mutiert innerhalb kurzer Zeit zum Menschen, nennt sich Polygraph Polygraphowitsch Lumpikow und macht das Leben des Professors zur Hölle auf Erden. Nicht weniger fantastisch geht es in „Die verfluchten Eier“ zu. Hier forscht der Zoologe Professor Wladimir Ipatjewitsch Pfirsichow leidenschaftlich an diversen Amphibien. Durch Zufall entdeckt er eines Tages einen mysteriösen roten Strahl, der Amöben und Frösche zum Riesenwuchs animiert und deren Aggressivität ins Unermessliche steigert. Als eine Hühnerkrankheit das Federvieh in ganz Russland ausrottet, sieht Alexander Semjonowitsch Vluch in Pfirsichows Entdeckung die Chance, dem geliebten Vaterland das Frühstücksei zurück zu bringen. Doch die Behandlung der vermeintlichen Hühnereier hat ungeahnte Folge.
Nicht weniger fantastisch geht es in „Die verfluchten Eier“ zu. Hier forscht der Zoologe Professor Wladimir Ipatjewitsch Pfirsichow leidenschaftlich an diversen Amphibien. Durch Zufall entdeckt er eines Tages einen mysteriösen roten Strahl, der Amöben und Frösche zum Riesenwuchs animiert und deren Aggressivität ins Unermessliche steigert. Als eine Hühnerkrankheit das Federvieh in ganz Russland ausrottet, sieht Alexander Semjonowitsch Vluch in Pfirsichows Entdeckung die Chance, dem geliebten Vaterland das Frühstücksei zurück zu bringen. Doch die Behandlung der vermeintlichen Hühnereier hat ungeahnte Folge.




















